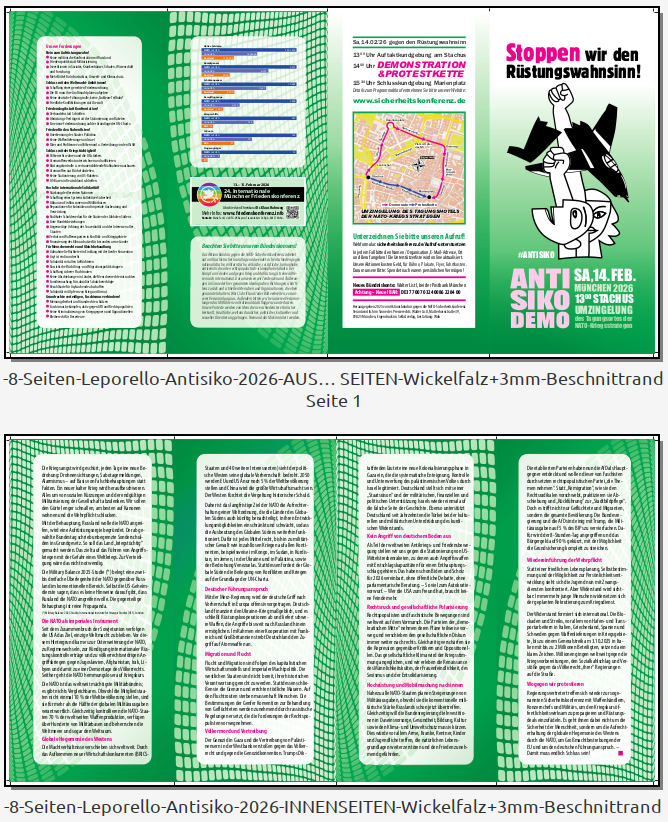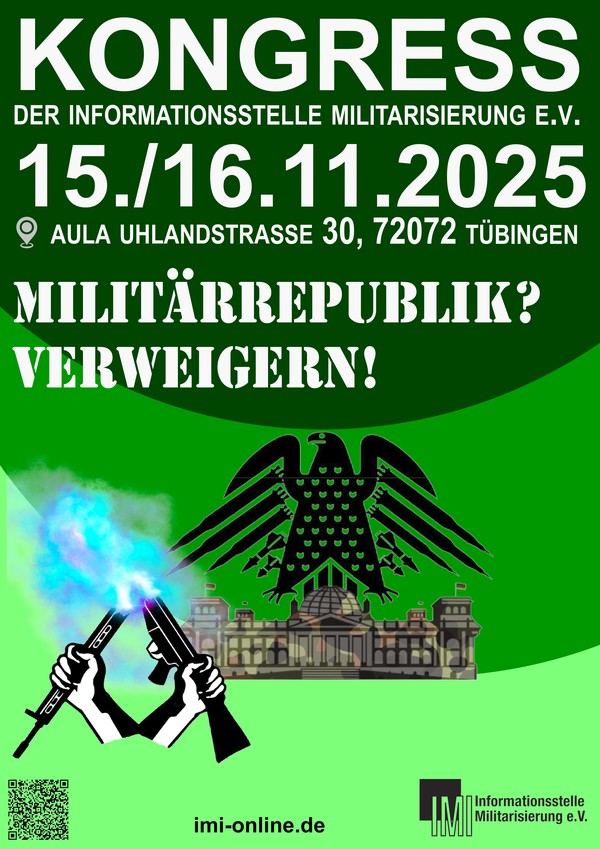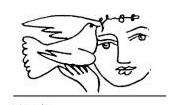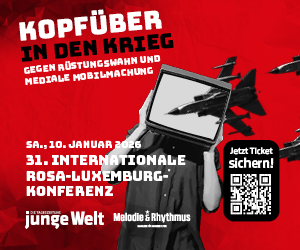Meldungen
Bremerhaven: Marinehafen
Venezuelas Ex-Außenminister: „Es gab keinen Regimewechsel“ – Nach der US-Entführung
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. Am 3. Januar kam es zu einem massiven Einsatz des US-Militärs in Caracas, bei dem Venezuelas Präsident Nicolás Maduro und First Lady Cilia […]
Der Beitrag Venezuelas Ex-Außenminister: „Es gab keinen Regimewechsel“ – Nach der US-Entführung erschien zuerst auf acTVism.
Bewegung im Wandel der „Zeitenwende“
Trump & Netanjahu signalisieren Eskalation ihres Genozids
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. Ende 2025 trafen sich Benjamin Netanjahu und Donald Trump erneut in den Vereinigten Staaten. Auf der anschließenden Pressekonferenz machten beide Aussagen, die weit […]
Der Beitrag Trump & Netanjahu signalisieren Eskalation ihres Genozids erschien zuerst auf acTVism.
Wie planen die USA Venezuela zu kontrollieren? | Glenn Greenwald
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, analysiert der Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald die US-Bombardierung Venezuelas und die anschließende […]
Der Beitrag Wie planen die USA Venezuela zu kontrollieren? | Glenn Greenwald erschien zuerst auf acTVism.
Venezuela: Das Interview, das in den Medien fehlt | Gregory Wilpert
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Gründer und Redakteur Zain Raza mit Gregory Wilpert, Soziologe und Mitbegründer von Venezuelanalysis, über die […]
Der Beitrag Venezuela: Das Interview, das in den Medien fehlt | Gregory Wilpert erschien zuerst auf acTVism.
Zukünftige Klimakatastrophe – gibt es noch hoffnungsvolle Perspektiven?
Seit mehreren Jahrzehnten ist der menschengemachte Klimawandel eines der zentralen globalen Probleme. Dennoch nimmt paradoxerweise der Skeptizismus gegenüber dieser wissenschaftlich gut belegten Tatsache in Teilen der Gesellschaft wieder zu. Dieser Text rekonstruiert die zentralen Argumente des Vortrags von Dr. Helmut Selinger, den er am 19. November 2025 in München gehalten hat. Der Text verbindet naturwissenschaftliche Erkenntnisse, politische Erfahrungen und gesellschaftstheoretische Überlegungen zu einer umfassenden Analyse der Klimakrise – sowie möglicher Auswege.
Zunehmender Skeptizismus gegenüber dem menschengemachten Klimawandel
Klimawandel-Skeptizismus tritt in unterschiedlichen Formen auf. Er reicht von offener Leugnung bis hin zu subtileren Formen der Relativierung. Prominente Beispiele finden sich im rechtspopulistischen und neoliberalen Spektrum, etwa bei Donald Trump oder der AfD. Trump bezeichnete den Klimawandel bereits 2012 als chinesische Erfindung zur Schwächung der US-Wirtschaft und sprach 2025 erneut vom „größten Schwindel aller Zeiten“.
Solche Positionen entstehen nicht zufällig. Sie sind eng mit den Interessen fossilistischer Konzerne verbunden, die gezielt eine breite klimaskeptische Szene finanzieren. Pseudowissenschaftliche Institute wie das EIKE werden dabei als scheinbar seriöse Quellen genutzt, um Zweifel an der Klimaforschung zu säen.
Die Leugnung des menschengemachten Klimawandels ist aus gesellschaftlicher Perspektive hochproblematisch. Sie untergräbt wissenschaftliche Erkenntnisse und blockiert notwendige politische Maßnahmen. Während eine kritische Diskussion über konkrete Klimaschutzmaßnahmen legitim und notwendig ist, stellt die grundsätzliche Infragestellung der Klimawissenschaft eine Form von Verantwortungslosigkeit dar.
Die globale Klimasituation – naturwissenschaftlich und klimapolitisch
Bereits seit den 1980er Jahren wird intensiv erforscht, welchen Anteil menschliche Aktivitäten an der globalen Erwärmung haben. Mit dem ersten Bericht des Weltklimarats (IPCC) im Jahr 1990 wurde diese Frage eindeutig beantwortet: Die Hauptursache der globalen Erwärmung sind die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen.
Seitdem haben zehntausende wissenschaftliche Studien diese Erkenntnis weiter untermauert. In sechs IPCC-Sachstandsberichten wurden die Ergebnisse regelmäßig zusammengefasst – mit einem klaren Trend: Die frühen Warnungen haben sich bestätigt, teils sogar als zu optimistisch erwiesen. Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur seit dem vorindustriellen Zeitalter ist unübersehbar.
Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute weltweit sichtbar: zunehmende Dürreperioden, ausgedehnte Waldbrände, häufigere und intensivere Hitzewellen, Starkregenereignisse mit Überschwemmungen, zerstörerische tropische Stürme sowie massive Verluste an Biodiversität. Hinzu kommen die Versauerung der Ozeane, das beschleunigte Abschmelzen der Polkappen und der Anstieg des Meeresspiegels. Besonders besorgniserregend ist die Gefahr, sogenannte Kipppunkte im Klimasystem zu überschreiten, nach denen sich Prozesse nicht mehr umkehren lassen.
Klimapolitik, Kapitalismus und die Frage globaler Gerechtigkeit
Obwohl das Problem des menschengemachten Klimawandels seit über 35 Jahren politisch anerkannt ist, fällt die Bilanz der internationalen Klimapolitik ernüchternd aus. Seit Mitte der 1990er Jahre fanden nahezu jährlich große UN-Klimakonferenzen statt – von Kyoto über Paris bis zuletzt Belém im Jahr 2025. Trotz dieser Vielzahl an Gipfeln, Abkommen und politischen Selbstverpflichtungen sind die globalen Treibhausgasemissionen kontinuierlich weiter angestiegen. Dies macht deutlich, dass die bisherigen klimapolitischen Ansätze weder in ihrer Zielsetzung noch in ihrer Umsetzung ausreichend waren, um der Dynamik der Klimakrise wirksam zu begegnen.
Die Ursachen dieses Scheiterns liegen nicht allein im fehlendem politischen Willen einzelner Staaten, sondern in den strukturellen Rahmenbedingungen, innerhalb derer Klimapolitik heute stattfindet. Eine wirksame Klimastrategie würde voraussetzen, dass in allen Ländern ambitionierte Maßnahmen zur drastischen Reduktion von Treibhausgasemissionen ergriffen werden. Darüber hinaus müsste die internationale Klimapolitik konsequent am Prinzip der globalen Klimagerechtigkeit ausgerichtet sein. Denn ein zentraler Widerspruch der Klimakrise besteht darin, dass jene Länder des globalen Südens, die historisch am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen haben, heute oft am stärksten von ihren Folgen betroffen sind. Ein gerechter Ausgleich zwischen globalem Norden und Süden – etwa durch finanzielle Transfers, Technologietransfer und die Anerkennung von Klimaschulden – wäre daher unabdingbar.
An diesem Punkt stößt die bisherige Klimapolitik jedoch an eine grundlegende Grenze: Sie bewegt sich fast ausschließlich innerhalb der Logik des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Jenseits parteipolitischer Differenzen stellt sich deshalb die grundsätzliche Frage, ob der Kapitalismus mit ökologischer Nachhaltigkeit überhaupt vereinbar ist. Der Kapitalismus ist strukturell auf permanentes Wirtschaftswachstum, Profitmaximierung und Konkurrenz angewiesen. In Situationen, in denen ökologische Erfordernisse mit ökonomischen Interessen kollidieren, setzt sich in der Regel der Profit durch – nicht der Umwelt- oder Klimaschutz.
Versuche, diese strukturelle Spannung durch eine „grüne“ Modernisierung des Kapitalismus aufzulösen, etwa in Form eines Green New Deal oder klima-keynesianischer Investitionsprogramme, beruhen auf der Annahme, dass sich Wirtschaftswachstum dauerhaft von Umweltbelastung und CO₂-Emissionen entkoppeln lasse. Empirisch lässt sich eine solche Entkopplung jedoch bislang nicht belegen, insbesondere wenn langfristige Effekte und Rebound-Effekte berücksichtigt werden. Effizienzgewinne werden häufig durch steigenden Konsum wieder aufgehoben, sodass der ökologische Gesamteffekt begrenzt bleibt.
Eine wirksame und nachhaltige Lösung der Klimakrise würde daher eine grundlegende Transformation des Wirtschaftsmodells erfordern. Für die Länder des globalen Nordens bedeutet dies eine bewusste Reduktion von Produktion und Konsum auf ein ökologisch tragfähiges Niveau, während es im globalen Süden zunächst darum geht, die materiellen Voraussetzungen für ein gutes, menschenwürdiges Leben zu sichern. Diese unterschiedliche Ausgangslage macht deutlich, dass Klimaschutz ohne globale Gerechtigkeit nicht möglich ist. Gleichzeitig zeigt die bisherige Erfahrung, dass ein solcher Ausgleich innerhalb des kapitalistischen Systems kaum realisierbar erscheint, da dieses auf Wachstum, Externalisierung und Ungleichheit angewiesen ist.
Die Klimakrise erweist sich damit nicht nur als ökologische, sondern als zutiefst systemische Krise. Sie stellt die bestehende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung grundsätzlich in Frage und macht deutlich, dass effektiver Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Organisation untrennbar miteinander verbunden sind.
Ökologische Marx-Neuinterpretation, Degrowth und gesellschaftliche Perspektiven
Angesichts der ökologischen Zuspitzung der Klimakrise gewinnt eine grundlegende theoretische Neubewertung kapitalismuskritischer Ansätze an Bedeutung. In diesem Zusammenhang rückt insbesondere eine ökologische Relektüre des Marxismus in den Fokus. Der japanische Philosoph Kohei Saito hat gezeigt, dass Karl Marx in seinen späten Lebensjahren ökologische Fragen intensiv studierte und seine Kritik des Kapitalismus weiterentwickelte. Marx erkannte zunehmend, dass die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen neben der Ausbeutung der Arbeitskraft einen zentralen inneren Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise darstellt.
Aus dieser Perspektive interpretiert Saito den späten Marx als Vordenker eines sogenannten Degrowth-Kommunismus. Gemeint ist eine Gesellschaftsform, die sich bewusst vom Wachstumszwang löst und stattdessen auf kollektives Eigentum, ökologische Nachhaltigkeit und demokratische Selbstverwaltung ausgerichtet ist. Diese Vision unterscheidet sich grundlegend von staatssozialistischen Modellen des 20. Jahrhunderts. Sie zielt nicht auf zentralistische Planung, sondern auf eine dezentrale, egalitäre und ökologisch eingebettete Organisation von Wirtschaft und Gesellschaft, in der Produktion und Reproduktion an realen gesellschaftlichen Bedürfnissen orientiert sind.
Der Begriff Degrowth wird dabei ausdrücklich nicht als Verzichtsideologie verstanden, die Armut oder Einschränkung romantisiert. Vielmehr geht es um eine radikale Reduktion ökologisch zerstörerischer, gesellschaftlich überflüssiger Produktion – insbesondere von Luxusgütern, Statussymbolen und ressourcenintensivem Konsum – bei gleichzeitiger Wiedergewinnung eines allgemeinen öffentlichen Reichtums. Historische Gemeingüter, sogenannte Commons, waren keineswegs von Mangel geprägt. Erst durch die kapitalistische Durchsetzung von Privateigentum und Marktlogik wurde gesellschaftlicher Reichtum systematisch in Knappheit und Ungleichheit überführt.
Zentrale Elemente einer solchen postkapitalistischen Perspektive sind die Demokratisierung von Energie, Infrastruktur und Produktion. Bürgerenergie, Genossenschaften, Commons-basierte Produktionsformen und offene Technologien spielen dabei eine Schlüsselrolle. Insbesondere erneuerbare Energien eignen sich aufgrund ihrer dezentralen Struktur für demokratische Kontrolle und kollektive Verwaltung. Langfristig geht es um eine Wirtschaftsweise, in der Gebrauchswerte, soziale Beziehungen, kulturelle Tätigkeiten und freie Zeit wichtiger werden als monetäres Wachstum und Profitmaximierung.
Eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zu einer solchen Gesellschaft liegt weniger in technischen oder materiellen Fragen als in der gesellschaftlichen Vorstellungskraft. Es scheint oft leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Dennoch existieren weltweit bereits soziale Bewegungen, Gemeinschaften und Netzwerke, die alternative Formen des Wirtschaftens und Zusammenlebens praktisch erproben. Diese Initiativen zeigen, dass andere gesellschaftliche Modelle nicht nur denkbar, sondern bereits ansatzweise real sind – und dass Hoffnung weniger aus abstrakten Entwürfen als aus konkreter kollektiver Praxis entsteht.
Quelle:
Vortragsfolien „Zukünftige Klimakatastrophe – gibt es noch hoffnungsvolle Perspektiven?“ von Dr. Helmut Selinger, 19.11.2025
Download:
Yanis Varoufakis: 2025 war der Wendepunkt – Europas Zerfall beginnt
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video übermittelt der Ökonom und ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis eine Neujahrsbotschaft von DiEM25, in der er darlegt, dass das Wirtschaftsmodell […]
Der Beitrag Yanis Varoufakis: 2025 war der Wendepunkt – Europas Zerfall beginnt erschien zuerst auf acTVism.
Donroe-Doktrin: Trumps Angriff auf Venezuela ist Teil eines imperialistischen Plans zur Durchsetzung der US-Vorherrschaft in Lateinamerika
Donald Trumps Bombardierung Venezuelas und die Entführung von Präsident Maduro sind Teil eines größeren imperialistischen Plans, um die Vorherrschaft der USA in Lateinamerika durchzusetzen, die natürlichen Ressourcen der Region (Öl, Gas, wichtige Mineralien, Seltene Erden) zu kontrollieren, eine neue Lieferkette als Ersatz für China zu schaffen, und China aus Lateinamerika zu verdrängen.
von Ben Norton
Die Vereinigten Staaten haben nicht nur gegen Venezuela, sondern gegen ganz Lateinamerika einen Frontalangriff gestartet – und sogar gegen das Grundkonzept der Souveränität.
Donald Trump befahl dem US-Militär am 3. Januar, Venezuela zu bombardieren, seinen verfassungsmäßigen Präsidenten Nicolás Maduro zu kidnappen und ihn nach New York zu verschleppen, um dort mit politisch motivierten Anschuldigungen gegen ihn einen Schauprozess zu führen.
Dieser dreiste Angriff auf Venezuela ist Teil einer größeren imperialistischen Offensive der USA in ganz Lateinamerika. Die Trump-Regierung beruft sich offen auf die 202 Jahre alte koloniale Monroe-Doktrin und hat sie für das 21. Jahrhundert aktualisiert, wobei sie sie stolz als "Donroe-Doktrin" bezeichnet.
Mit dem Angriff auf Venezuela hofft das US-Imperium, mehrere Ziele zu erreichen:
• Die Vorherrschaft der USA in Lateinamerika durchsetzen (von der Monroe-Doktrin zur Donroe-Doktrin).
• Die natürlichen Ressourcen Venezuelas (Öl, Gas, wichtige Mineralien und Seltenerdmetalle) ausbeuten, um eine neue Lieferkette in der westlichen Hemisphäre aufzubauen.
• Die Beziehungen Lateinamerikas zu China (sowie zu Russland und Iran) unterbrechen.
• Andere linke Regierungen in der Region (vor allem Kuba und Nicaragua, aber auch Brasilien und Kolumbien) bedrohen.
• Das Projekt der regionalen Integration in Lateinamerika und der Karibik (in Organisationen wie ALBA und CELAC) zerstören.
• Die Einheit des Globalen Südens sabotieren (angesichts der Unterstützung Venezuelas für Palästina, den Iran, afrikanische Befreiungskämpfe usw.).
Trump übernimmt die koloniale Monroe-Doktrin
Der Gesamtplan des US-Imperiums wird in der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 der Trump-Regierung klar dargelegt. [1]
Das Dokument verdeutlicht, wie die USA versuchen, ihre Vorherrschaft gewaltsam in der gesamten westlichen Hemisphäre durchzusetzen. Es beruft sich offen auf die Monroe-Doktrin.
Vertreter der US-Regierung haben diese koloniale Doktrin, die bis ins Jahr 1823 zurückreicht, begeistert aufgegriffen.
Nur wenige Stunden nach dem Angriff der US-Regierung auf Venezuela veröffentlichte ein offizieller Twitter-Account von Trump ein Propagandabild, die den US-Präsidenten über ganz Amerika stehend zeigt, von Alaska an der Spitze Nordamerikas bis nach Argentinien am Ende Südamerikas, mit einem großen Knüppel in der Hand, auf dem "Donroe Doctrine" steht.[2]
Das Bild war eine Anspielung auf eine politische Karikatur zur Monroe-Doktrin aus dem Jahr 1905. US-Kriegsminister Pete Hegseth repostete es auf seinem offiziellen Regierungsaccount.
Das US-Imperium will die natürlichen Ressourcen Lateinamerikas kontrollieren
Die Nationale Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung betonte, dass das Ziel darin besteht, dass US-Unternehmen alle strategischen natürlichen Ressourcen der westlichen Hemisphäre kontrollieren, einschließlich kritischer Mineralien und Seltenerdelemente.
Es ist keineswegs ein zufälliger Zusammenhang, dass Venezuela über die weltweit größten Ölreserven verfügt. Obwohl die USA heute der größte Ölproduzent der Welt und Nettoexporteur von Öl sind, sind sie nach wie vor stark von Importen von Schweröl abhängig. Ein Großteil davon stammt aus Kanada (der kanadische Anteil ist von 15% 1995 auf aktuell 60% gestiegen), da ist das Schweröl aus Venezuela eine potenzielle alternative Quelle.
Trump hat deutlich gemacht, dass er möchte, dass US-Unternehmen die Ölindustrie Venezuelas übernehmen, damit die USA ihren Bedarf an Schweröl decken können. (Die Ersetzung der kanadischen Schwerölexporte könnte Washington auch Einfluss auf Ottawa verschaffen, zu einer Zeit, in der Trump davon spricht, Kanada zu kolonisieren und es zum "51. Bundesstaat" zu machen.
In einer Pressekonferenz nach dem Bombenangriff auf Venezuela erklärte Trump, dass die US-Regierung "das Land regieren" werde. Er fügte hinzu: "Wir werden unsere sehr großen US-Ölkonzerne, die größten der Welt, dorthin schicken, damit sie Milliarden von Dollar investieren, die stark beschädigte Infrastruktur, die Ölinfrastruktur, reparieren und anfangen, Geld zu verdienen."
"Wir sind im Ölgeschäft", betonte der US-Präsident. "Wir werden eine enorme Menge an Reichtum aus dem Boden holen."
https://youtu.be/XZHOuHUboeY
Nachdem das US-Militär Venezuela bombardiert und Präsident Nicolás Maduro entführt hatte, sagte Donald Trump: "Wir werden das Land regieren", möglicherweise jahrelang. "Wir sind im Ölgeschäft", fügte er hinzu und prahlte damit, dass US-Konzerne die Bodenschätze Lateinamerikas ausbeuten würden.
Eine neue, von den USA kontrollierte Lieferkette für kritische Mineralien, die China ausschließt
Neben enormen Öl- und Erdgasvorkommen verfügt Venezuela auch über bedeutende Vorkommen an Gold, kritischen Mineralien und Seltenerdelementen [3].
Die US-Regierung hat deutlich gemacht, dass sie eine neue Lieferkette in der westlichen Hemisphäre schaffen will, die China ausschließt, um sich auf zukünftige Konflikte mit Peking vorzubereiten. Sie hofft, dafür die kritischen Mineralien und Seltenen Erden Lateinamerikas nutzen zu können.
Dies ist auch ein wichtiger Grund, warum Trump Grönland kolonisieren und plündern will, das über 25 der 30 Materialien verfügt, die von der Europäischen Union als "kritisch" eingestuft werden.
In der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 bekräftigt die Trump-Regierung, dass US-Unternehmen die "Energieinfrastruktur" und den "Zugang zu kritischen Mineralien" Lateinamerikas kontrollieren müssen. Die US-Regierung schreibt, dass sie "kritische Lieferketten in dieser Hemisphäre stärkt", um "Abhängigkeiten" und "schädliche Einflüsse von außen" zu reduzieren – ein offensichtlicher Verweis auf China.
Realistischere Vertreter der Trump-Regierung haben erkannt, dass der Großteil der Produktion nicht wirklich in die USA zurückkehren wird (wo die Zahl der Arbeitsplätze in der Fertigungsindustrie seit Jahrzehnten stetig sinkt, selbst unter Trump), und geben daher in der Nationalen Sicherheitsstrategie zu, dass sie eine "Nearshore-Produktion” in Lateinamerika anstreben. US-Unternehmen möchten die niedrig bezahlten lateinamerikanischen Arbeitskräfte für die Herstellung ihrer Produkte nutzen und China damit umgehen.
Dies ist auch einer der Gründe, warum eine neue, von den USA dominierte Lieferkette in der westlichen Hemisphäre angestrebt wird: Nicht nur, weil der militärisch-industrielle Komplex der USA China aus der Lieferkette für die Waffen, die er zur Vorbereitung auf einen möglichen zukünftigen Krieg mit China herstellt, ausschließen muss, sondern auch, weil Washington eine wirtschaftliche Abkopplung von China anstrebt und glaubt, dass Lateinamerika dabei helfen kann.
Die strategische Infrastruktur Lateinamerikas
Darüber hinaus strebt das US-Imperium die Kontrolle über die gesamte strategische Infrastruktur in Lateinamerika an.
In der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 heißt es, Washington werde "strategische Punkte und Ressourcen in der westlichen Hemisphäre identifizieren" und fügt hinzu: "Die US-Regierung wird strategische Akquisitions- und Investitionsmöglichkeiten für amerikanische Unternehmen in der Region identifizieren".
Die Trump-Regierung droht lateinamerikanischen Ländern unverhohlen, China zu zwingen, alle seine Investitionen in regionale Infrastrukturprojekte zu verkaufen.
Die US-Regierung hat Panama bereits erfolgreich angewiesen, Druck auf das Hongkonger Unternehmen CK Hutchison Holdings auszuüben, das die Häfen rund um den Panamakanal besitzt, damit es diese an den Wall-Street-Riesen BlackRock verkauft.
Es ist wahrscheinlich, dass die USA auch den peruanischen Hafen Chancay ins Visier nehmen werden, einen der wichtigsten Häfen der Region, der von China gebaut wurde. Trumps Lateinamerika-Berater Mauricio Claver-Carone schlug vor "Jedes Produkt, das über Chancay oder einen anderen Hafen in der Region, der China gehört oder von China kontrolliert wird, transportiert wird, sollte mit einem Zollsatz von 60 % belegt werden".
In Washington wurde sogar über mögliche Maßnahmen diskutiert, um lateinamerikanische Regierungen zu zwingen, Beschränkungen für chinesische Investitionen in der Region zu verhängen.
US-Intervention in Lateinamerika im Zweiten Kalten Krieg
Die Nationale Sicherheitsstrategie 2025 zeigt, wie sehr die Trump-Regierung davon besessen ist, Chinas Beziehungen zu Ländern in Lateinamerika einzuschränken. Dies ist der zweite Kalte Krieg.
Auf seiner ersten Auslandsreise als Außenminister reiste Marco Rubio nach Panama, wo er das mittelamerikanische Land zwang, sich aus Chinas Belt and Road Initiative (BRI) zurückzuziehen. Die Trump-Regierung erhöht den Druck der USA auch auf andere Länder in der Region, sich aus der BRI zurückzuziehen, erheblich.
Ebenso mischte sich Trump 2025 unverhohlen in die Wahlen in Honduras ein und unterstützte einen Wahlputsch. Trump begnadigte und entließ auch einen der schlimmsten Drogenhändler der Welt aus dem Gefängnis, den von den USA unterstützten rechten ehemaligen Diktator von Honduras, Juan Orlando Hernández. Er war nach seiner Auslieferung in die USA im Juni 2024 von einem US-Gericht zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Seine Begnadigung verdeutlicht, dass die Trump-Regierung sich in Wirklichkeit nicht um den Drogenhandel kümmert, sondern ihn lediglich als zynische Ausrede benutzt, um die unabhängigen Regierungen in der Region anzugreifen und zu destabilisieren.
Der rechtsgerichtete Verbündete Trumps, der nun im Namen der USA Honduras regieren wird, der Oligarch Nasry "Tito" Asfura, hat geschworen, die diplomatischen Beziehungen zur Volksrepublik China offiziell abzubrechen und die taiwanesischen Separatisten anzuerkennen.
Die USA wollen Honduras auch als Operationsbasis für Angriffe auf die sandinistische Regierung im benachbarten Nicaragua nutzen.
Nach der Bombardierung und Besetzung Venezuelas hoffen Trump und Marco Rubio, ähnliche imperialistische Regimewechselkriege gegen Kuba und Nicaragua führen zu können. Rubio hat seine gesamte Karriere dem Sturz ihrer antiimperilialistischen Revolutionen gewidmet. Für den Exilkubaner ist es ein politischer Kreuzzug.
Auf der Pressekonferenz, die Trump und Rubio nach der Bombardierung Venezuelas und der Entführung von Präsident Maduro gaben, drohten sie sogar offen Kuba und dem linksgerichteten Präsidenten Kolumbiens, Gustavo Petro.
Das Ziel der Trump-Regierung ist einfach: In jedem Land Lateinamerikas sollen rechtsgerichtete US-Marionettenregime eingesetzt werden, die gehorsam den Interessen Washingtons und der Wall Street dienen und ihre Vermögenswerte an US-Investoren verkaufen.
Im Jahr 2026 stehen zwei wichtige Wahlen in Ländern mit linken Regierungen an: Brasilien (im Oktober) und Kolumbien (im Mai). Es ist sicher, dass die Trump-Regierung sich in diese Wahlen einmischen wird, um zu versuchen, unterwürfige rechte Verbündete der USA (wie Javier Milei in Argentinien) an die Macht zu bringen.
Trump hat auch damit gedroht, Mexiko zu bombardieren, das eine unabhängige, blockfreie Regierung unter der Führung der linken Präsidentin Claudia Sheinbaum hat (die mit einer konstanten Zustimmungsrate von rund 74 % eine der beliebtesten Politikerinnen der Welt ist).
Mexiko hat sich entschieden gegen diese Drohungen der USA gewehrt und erklärt, dass sie einen Angriff auf die Souveränität Mexikos darstellen würden. Aber wie Trumps Krieg gegen Venezuela gezeigt hat, schert sich das US-Imperium nicht im Geringsten um Souveränität.
Von der Monroe-Doktrin zur Donroe-Doktrin: die Nationale Sicherheitsstrategie 2025
Um die Pläne des US-Imperiums für Lateinamerika besser zu verstehen, ist es wichtig, sich die Details der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 (NSS) der Trump-Regierung anzusehen.
In diesem Dokument wird die westliche Hemisphäre als die wichtigste Region für die US-Außenpolitik identifiziert. Die Trump-Regierung erklärte, sie wolle eine Region, die "frei von feindlichen ausländischen Übergriffen oder dem Besitz wichtiger Vermögenswerte bleibt und die kritische Lieferketten unterstützt", in der die USA "weiterhin Zugang zu wichtigen strategischen Standorten haben".
Die NSS erklärte unmissverständlich, dass "die Vereinigten Staaten die Monroe-Doktrin bekräftigen und durchsetzen werden, um die Vorrangstellung Amerikas in der westlichen Hemisphäre wiederherzustellen".
In einer Pressekonferenz, die Trump wenige Stunden nach der Bombardierung Venezuelas und der Entführung von Präsident Maduro gab, wiederholte er diese Rhetorik. Trump lobte die Monroe-Doktrin und sagte: "Wir haben sie um einiges, um wirklich einiges, übertroffen. Man nennt sie jetzt die Donroe-Doktrin". Er fügte hinzu: "Wir bekräftigen die amerikanische Macht in unserer Heimatregion auf sehr eindringliche Weise".
In der NSS 2025 erklärt die Trump-Regierung, sie werde "nicht-hemisphärischen Konkurrenten die Möglichkeit verweigern, Streitkräfte oder andere bedrohliche Fähigkeiten in unserer Hemisphäre zu positionieren oder strategisch wichtige Vermögenswerte zu besitzen oder zu kontrollieren”. Dies ist ein offensichtlicher Verweis auf China.
Das Dokument macht unmissverständlich klar, dass Washington nach Vorherrschaft strebt. Es heißt:
"Die Vereinigten Staaten müssen in der westlichen Hemisphäre eine herausragende Stellung einnehmen, als Voraussetzung für unsere Sicherheit und unseren Wohlstand – eine Voraussetzung, die es uns ermöglicht, uns selbstbewusst zu behaupten, wo und wann immer wir dies in der Region benötigen. Die Bedingungen unserer Allianzen und die Bedingungen, unter denen wir jegliche Art von Hilfe leisten, müssen davon abhängig gemacht werden, dass feindliche Einflüsse von außen zurückgedrängt werden – von der Kontrolle über militärische Einrichtungen, Häfen und wichtige Infrastruktur bis hin zum Kauf von strategischen Vermögenswerten im weitesten Sinne."
Die Trump-Regierung versucht nicht einmal, die Tatsache zu verbergen, dass sie sich nicht um die Souveränität der Länder Lateinamerikas schert und mehr als bereit ist, diese zu verletzen.
"Wir wollen, dass andere Nationen uns als ihren Partner erster Wahl sehen, und wir werden (mit verschiedenen Mitteln) ihre Zusammenarbeit mit anderen verhindern", heißt es in der NSS.
Das Dokument formulierte eine manichäische Teilung der Welt im Stil des Kalten Krieges:
"Alle Länder stehen vor der Wahl, ob sie in einer von den USA geführten Welt souveräner Länder und freier Volkswirtschaften leben wollen oder in einer parallelen Welt, in der sie von Ländern auf der anderen Seite der Welt beeinflusst werden."
Die "Trump-Konsequenz" zur Monroe-Doktrin
Die Nationale Sicherheitsstrategie 2025 erklärt, dass das US-Imperium "ein 'Trump-Korollar' (Anm.: triviale Schlussfolgerung) zur Monroe-Doktrin durchsetzen und geltend machen wird".
Dies war ein Verweis auf das "Roosevelt-Korollar", das der Erzimperialist Theodore "Teddy" Roosevelt in seiner Rede zur Lage der Nation 1904 vorschlug, als er Folgendes erklärte:
"Chronisches Fehlverhalten oder eine Ohnmacht, die zu einer allgemeinen Lockerung der Bindungen der zivilisierten Gesellschaft führt, kann in Amerika wie auch anderswo letztendlich das Eingreifen einer zivilisierten Nation erforderlich machen, und in der westlichen Hemisphäre kann die Einhaltung der Monroe-Doktrin durch die Vereinigten Staaten diese in eklatanten Fällen solchen Fehlverhaltens oder solcher Ohnmacht, wenn auch widerstrebend, zur Ausübung einer internationalen Polizeimacht zwingen.
…
Unsere Interessen und die unserer südlichen Nachbarn sind in Wirklichkeit identisch. Sie verfügen über große natürliche Reichtümer, und wenn innerhalb ihrer Grenzen Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit herrschen, wird ihnen mit Sicherheit Wohlstand zuteil werden.
…
Mit der Durchsetzung der Monroe-Doktrin, mit den Maßnahmen, die wir in Bezug auf Kuba, Venezuela und Panama ergriffen haben, und mit unseren Bemühungen, den Kriegsschauplatz im Fernen Osten einzuschränken und die offene Tür in China zu sichern, haben wir sowohl in unserem eigenen Interesse als auch im Interesse der gesamten Menschheit gehandelt."
Auffällig ist, dass die Ziele der imperialistischen Aggression von Teddy Roosevelt im Jahr 1904 – China, Venezuela, Kuba und Panama – teilweise dieselben sind wie die Ziele Washingtons heute.
Trump hat Teddy Roosevelts imperialistische "Big Stick"-Doktrin und Kanonenbootdiplomatie wiederbelebt. Mit ihrem "Trump-Korollar" erklärt die US-Regierung, dass sie glaubt, das Recht zu haben, überall in Lateinamerika und der Karibik militärisch zu intervenieren, wann immer sie will. Es handelt sich um eine explizit imperialistische Politik, die darauf abzielt, den Nationen der Region ihre Rechte auf Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstbestimmung zu verweigern, die im Völkerrecht und in der UN-Charta verankert sind.
Der Angriff der Trump-Regierung auf Venezuela ist Teil eines größeren imperialistischen Angriffs auf Lateinamerika und den Globalen Süden im Allgemeinen.
Die offene Brutalität und Grausamkeit des US-Imperiums zeigen ebenfalls, wie kindisch und lächerlich die "Demokratie"-Rhetorik westlicher Politiker und Experten ist, wenn sie belagerte Länder des Globalen Südens wie Venezuela beschuldigen, angeblich "autoritär" zu sein.
Es ist für die Nationen Lateinamerikas (und des Globalen Südens insgesamt) unmöglich, Demokratie zu praktizieren, wenn das mächtigste und tödlichste Imperium der Welt ständig in ihre Wahlen eingreift, sie angreift, Sanktionen gegen sie verhängt und Staatsstreiche unterstützt.
Wahre Demokratie ist unmöglich, solange der Imperialismus existiert.
Quelle: Geopolitical Economy Report, 5. Januar 2025: "Donroe Doctrine: Trump attack on Venezuela is part of imperial plan to impose US hegemony in Latin America"
https://geopoliticaleconomy.com/2026/01/05/donroe-doctrine-trump-venezuela-imperial-plan-latin-america/
Mit freundlicher Genehmigung von kommunisten.de
Anmerkungen:
[1] National Security Strategy of the United States of America, November 2025
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf
deutsche Übersetzung: https://www.cueni.ch/vollstaendige-deutsche-uebersetzung/
[2] Der offizielle Account des "War Room" von Präsident Donald J. Trumps politischer Kampagne.
https://x.com/TrumpWarRoom/status/2007558804582609344
[3] Anm. kommunisten.de: Venezuela verfügt über die größten Goldreserven Lateinamerikas. Die Goldreserven Venezuelas sind mit 161 Tonnen im Wert von 22-23 Mrd. USD bei aktuellen Preisen bestätigt. Seit 2018 sind venezolanische Goldreserven im Wert von 1,8 Milliarden Dollar bei der Bank von England eingefroren. Der Orinoco-Bergbaubogen birgt 10.000 Tonnen unerschlossenes Gold. Bei einem aktuellen Preis von 4.360 Dollar pro Unze wären das 1,4 Billionen Dollar im Boden.
Die Schätzungen für Mineralien variieren bis zu 44.000 Tonnen insgesamt.
Allein das Coltan, das "blaue Gold", das für jedes Smartphone und jede Elektroauto-Batterie unersetzlich ist, hat einen Wert von über 100 Milliarden Dollar.
Die Ölförderung erfordert Investitionen in Höhe von 58 Milliarden Dollar in den Wiederaufbau der veralteten Infrastruktur. Es wird Jahre dauern, bis die Produktion wieder ihren Höchststand erreicht.
Gold lagert in den Tresoren der Zentralbanken. Sobald eine von den USA anerkannte Übergangsregierung die Kontrolle übernimmt, dient dieses Gold als Sicherheit für IWF-Kredite, Wiederaufbaufinanzierungen und Schuldenrestrukturierungen.
Obwohl alle von Öl sprechen, ist Gold derzeit wichtiger als Öl.
Chinas Klimaziele und das Projekt „Grüne Große Mauer”. Zum Fertigungsstand des weltgrößten Aufforstungsprogramms
Chinas „Grüne Mauer“ (Three-North Shelterbelt Development Program) ist das weltweit größte Aufforstungsprojekt und zielt seit 1978 darauf ab, die fortschreitende Verwüstung im Norden des Landes zu stoppen und landwirtschaftliche sowie bewohnbare Flächen zu sichern. „Drei Norden“ (Three-North Shelterbelt) bezieht sich auf den Nordosten, Norden und Nordwesten Chinas – die Gebiete, die am stärksten von Wüstenbildung bedroht sind, Gebiete, die aber aufgrund der Bevölkerungszahl bewohnbar bleiben müssen.
Die „große Grüne Mauer“
Das Projekt spielt eine Schlüsselrolle für die Erreichung der chinesischen Klimaziele, da es gleich auf mehreren Ebenen ansetzt: Neben dem geplanten Stopp der Wüstenbildung wird CO₂ gebunden und gleichzeitig entsteht ein großes klimafreundliches Potential für die spätere Stromerzeugung.
Bis zum geplanten Abschluss im Jahr 2050 soll ein schützender Grüngürtel von über 4.500 Kilometern Länge entstehen, der 14 Provinzen durchzieht und rund 400.000 km² umfasst. Das entspricht mehr als der Fläche Deutschlands.
Im Juli 2025 ist in der inneren Mongolei, einer nördlichen Region Chinas, als Bestandteil des Gesamt-Projektes ein grüner Sandschutzgürtel fertiggestellt worden als Voraussetzung für die Wiederaufforstung, der sich über drei Wüsten erstreckt und einen weiteren Meilenstein bei der Schaffung der besagten grünen Mauer in der trockenen nördlichen Region darstellt.
Damit ist ein 1.856 km langer grüner Gürtel fertiggestellt. Die einbezogenen drei Wüsten, im westlichsten Teil der Inneren Mongolei liegend, umfassen eine Gesamtfläche von 94.700 km², das entspricht in etwa 83 % der gesamten Wüstenfläche der Inneren Mongolei.
Zur Sandstabilisierung und Eindämmung der Wüstenbildung wird eine in China weit verbreitete Methode, die Strohkaromuster eingesetzt: Bündel aus Stroh werden in quadratischen Feldern (Karos, etwa 1 x 1 Meter groß) auf der Oberfläche der Sanddünen verlegt und teilweise in den Sand eingegraben. Diese Strohkaros (siehe Bild unten) bilden ein Schachbrett auf dem Sand, wodurch der Wind abgebremst und der Sand stabilisiert wird. So wird verhindert, dass der Sand weiter verweht und die Dünen „wandern“. Insbesondere entlang von Straßen, Eisenbahnen und an besonders gefährdeten Stellen wird dieses Verfahren angewendet, um Infrastruktur zu schützen, aber auch, um die Grundlage für nachfolgende Maßnahmen wie Bepflanzungen zu schaffen. Aus Messungen geht hervor, dass die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge dort weniger als 200 mm ausmacht, während die Verdunstung mit über 3.000 mm etwa 15-mal so hoch ist und damit die Wüstenbildung vorantreibt.
Anlegen von Strohkaros, Voraussetzung für die Bepflanzung mit widerstandsfähigen Sträuchern wie Saxaul.
Das jetzt abgeschlossene Teilprojekt im westlichen Teil der inneren Mongolei zur Verbindung der bestehenden Gürtel über die drei Wüsten wurde im Februar gestartet.
Das Projekt ist die jüngste Phase der jahrzehntelangen Bemühungen Chinas, die Wüstenbildung in seinen trockenen nördlichen Regionen durch Sandbekämpfungsmaßnahmen und Wiederaufforstung aufzuhalten.
Das Programm
Das Programm „Grüne Mauer“ begann 1978 als Reaktion auf schwere ökonomische, ökologische und soziale Folgen der Desertifikation, d.h. die fortschreitende Verschlechterung von Land in trockenen Gebieten aufzuhalten, die durch menschliche Aktivitäten und den Klimawandel verursacht wird. Desertifikation führt zum Verlust von Vegetation, Bodenerosion und Verlust landwirtschaftlicher Flächen durch Verringerung der Bodenfruchtbarkeit, was die Lebensgrundlage vieler Menschen gefährdet. Hinzu kommen häufige und zerstörerische Sandstürme, die nach wie vor bis in die Hauptstadt Beijing reichen.
Der Projektplan sieht vor, bis 2050 entlang einer Linie, die teilweise dem Verlauf der Großen Mauer entspricht, einen Schutzwald von insgesamt etwa 35 Millionen Hektar zu etablieren. Das entspricht einer Fläche von mehr als 40% der chinesischen Staatsfläche und 13 Provinzen umfasst.
Von 1978 bis heute wurden in dem Gürtel mehr als 60 Milliarden Bäume gepflanzt.
Die konkreten Ziele des Gesamtprojektes:
- Erhöhung der Waldfläche im Programmgebiet von etwa 5% auf bis zu 14%,
- Schutz vor Wind-, Sand- und Staubstürmen sowie Erosionsprozessen,
- Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsbedingungen der rund 170 Mio. Bewohner der Region, insbesondere der ländlichen und ärmeren Bevölkerung und
- Aufbau nachhaltiger Forst- und Obstwirtschaft zur Armutsbekämpfung und wirtschaftlichen Entwicklung.
Die Chinesischen Klimaziele: Aktueller Stand und Ökologische Bewertung
China bekennt sich zu dem Ziel, bis spätestens 2030 den Höhepunkt seiner CO2-Emissionen zu erreichen und spätestens 2060 klimaneutral („Carbon neutral“) zu werden.
Bis 2025 waren Zwischenziele wie rund 20 Prozent erneuerbare Energien am Endenergieverbrauch, eine Reduktion der CO2-Intensität um 18 Prozent und der Energieintensität um 13 Prozent – gemessen am Bruttoinlandsprodukt – vorgesehen. Der „Peak“ der Emissionen könnte durch den dynamischen Erneuerbaren-Ausbau schon 2025 überschritten werden, wobei der tatsächliche CO2-Ausstoß in den Jahren davor weiter angestiegen ist. Erwähnenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass bei Erreichung der Klimaziele und die Bestimmung, welches Land die Hauptverantwortung für die Klimaerwärmung trägt, auf die sogenannten historischen Emissionen hinzuweisen ist:
China gilt als einer der größten Emittenten, hat seit 1750 mit 220 Milliarden Tonnen, etwas mehr als halb so viel CO2 ausgestoßen wie die USA (410 Milliarden Tonnen). Deutschland schlägt in den historischen Emissionen mit 92 Milliarden Tonnen zu Buche und steht damit hinter Russland und vor Großbritannien auf Platz vier.
Internationale Anerkennung erfährt China durch seine massiven Investitionen in Photovoltaik, Windenergie und Elektromobilität: Die installierten Kapazitäten erneuerbarer Energien wachsen schneller als in jedem anderen Land. Prognosen gehen davon aus, dass China bis 2035 65 % seines Strombedarfs durch erneuerbare Energien abdecken könnte.
Gleichzeitig ist allerdings der Kohleverbrauch historisch hoch, nachdem China noch in der ersten Hälfte der 2010er Jahre etwa 5,7 Millionen Menschen im Kohlebergbau beschäftigte, während in den USA nur etwa 90.000 Beschäftigte nötig waren. Das bedeutet, der chinesische Kohlebergbau benötigte ein Vielfaches an Arbeitskräften pro geförderter Tonne, was auf einen niedrigeren Mechanisierungsgrad und teilweise schlecht ausgestattete, kleine Untertagebergwerke zurückzuführen ist. Kohlekraftwerke werden weiter genehmigt, um Versorgungsengpässe bei der Energieversorgung sicherzustellen und das Wirtschaftswachstum abzusichern. Jedoch sind die Beschäftigtenzahlen im Kohlebergbau inzwischen durch einen höheren Automatisierungsgrad deutlich zurückgegangen. Die Dissonanz zwischen Expansion der Erneuerbaren und dem Festhalten an fossilen Infrastrukturen sorgt für einen unübersehbaren Zielkonflikt.
Aktuell überrascht China mit einer positiven Entwicklung: Im ersten Quartal 2025 sind die Emissionen des Landes erstmals seit Jahren gesunken – trotz des wachsenden Energieverbrauchs. Der Wandel hin zu nachhaltiger Energieversorgung schreitet in Rekordtempo voran.
Chinas Anteil am verbleibenden CO2-Budget („Carbon Budget“) zur nach wie vor verbindlichen Eindämmung der Erderwärmung um 1,5 Grad (Pariser Abkommen von 2015) liegt nach aktuellen Rechnungen bei ca. 12 %. Das Land ist sich seiner mittragenden Schlüsselrolle in der Begrenzung der Erderwärmung bewusst, was sich in der Berücksichtigung der Klimaziele im derzeit diskutierten 15. Fünfjahresplan deutlich niederschlägt. China hat aufgrund seiner über 1,4 Mrd. Einwohner sehr hohe Gesamtemissionen, doch der Pro-Kopf-Ausstoß liegt mit rund 8,3 Tonnen CO2 deutlich unter den Werten der USA und deutlich unter den meisten Industrienationen.
Aus sozial-ökologischer Sicht ist zu konstatieren, dass die enormen Anstrengungen Chinas zur Reduzierung der Eindämmung des CO2-Ausstoßes und der wissenschaftlich belegte vorbildhafte Ausbau an erneuerbaren Energien, gemessen an den Pariser Klimazielen, nicht ausreichen. Die vermutlich politisch nicht mehr durchsetzbare Realisierung der Pariser Vereinbarung von 2015 ist an dieser Stelle nicht zu kommentieren.
Fairerweise ist aber anzumerken, dass bereits vor 40 Jahren westliche Länder damit begannen, energieintensive Produktionen nach China zu verlagern und die Emissionen produktionstechnisch seither China zugeordnet werden. Selbst nach der völkerrechtlich verbindlichen Messung von Emissionen seit 2005 (Basis Kyoto-Protokoll von 1997) hat sich daran nichts verändert. Der westliche Anteil an den Emissionen schwankt, je nach Quellenangabe, zwischen 9 und 20 % der chinesischen Emissionen.
Zwischenfazit zum Projekt „Grüne Mauer“
Das Projekt „Grüne Mauer“ ist eines der wichtigsten globalen Umweltprojekte und ein Experimentierfeld für die Menschheit im Umgang mit Desertifikation, Klimafolgen und Bevölkerungswachstum. Bis zum geplanten Abschluss im Jahr 2050 soll die Waldfläche auf rund 33,6 Millionen Hektar ausgebaut werden und der ökologische Sicherheitsgürtel entlang des Nordens Chinas weitgehend abgeschlossen sein.
Quellen:
https://sdgs.un.org/partnerships/three-north-shelterbelt-program
https://greenspotting.de/schon-wieder-china-nicht-nur-bei-cleantech-auch-bei-der-aufforstung-ist-das-reich-der-mitte-weltweit-vorreiter/
https://de.wikipedia.org/wiki/Chinas_Gr%C3%BCne_Mauer
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722064531
https://de.wikipedia.org/wiki/ChinasGrueneMauer
https://www.scmp.com/news/china/science/article
Our World in Data, Global Carbon Atlas
https://www.eeas.europa.eu/eeas/china
https://www.isw-muenchen.de/broschueren/reports/6-report-129
https://www.lunapark21.net/aufforstung-in-china-als-vorbild-auch-fuer-afrika
https://www.gtai.de/de/trade/china/specials/klimaziele-klimaneutralitaet-bis-2060
Ex-Oberst Wilkerson – Venezuela, Deutschland & der Zerfall des US-Imperiums
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Gründer und unterstützender Redakteur Zain Raza mit Oberst Lawrence Wilkerson (a.D.), dem ehemaligen Stabschef von […]
Der Beitrag Ex-Oberst Wilkerson – Venezuela, Deutschland & der Zerfall des US-Imperiums erschien zuerst auf acTVism.
Der Ukraine-Krieg als Ponzi-System: Wer zahlt die Milliarden?
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In dieser Analyse legt Dimitri Lascaris die finanzielle Realität hinter dem Ukraine-Krieg offen. Die Ukraine ist faktisch zahlungsunfähig, dennoch haben die EU und […]
Der Beitrag Der Ukraine-Krieg als Ponzi-System: Wer zahlt die Milliarden? erschien zuerst auf acTVism.
Die große Lüge der Globalisierung – Prof. Richard D. Wolff
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video zeichnet Professor Richard D. Wolff nach, wie sich die Globalisierung in den Vereinigten Staaten von einer gefeierten Wirtschaftsstrategie zu einem […]
Der Beitrag Die große Lüge der Globalisierung – Prof. Richard D. Wolff erschien zuerst auf acTVism.
Ein Lesebuch über die Friedensliebe der Rabbiner
Wurde Maduro verraten? – Was hinter dem US-Angriff auf Venezuela steckt
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. 48 Stunden nach der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die US-Streitkräfte stellt sich die Frage, ob der venezolanische Staatschef von ihm […]
Der Beitrag Wurde Maduro verraten? – Was hinter dem US-Angriff auf Venezuela steckt erschien zuerst auf acTVism.
Prof. Jeffrey Sachs: Scharfe Kritik an den USA vor der UN wegen Venezuela
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. Dieser Podcast basiert auf einer Rede des weltbekannten Ökonomen und UN-Beraters Prof. Jeffrey Sachs, die er am 6. Januar 2026 vor dem UN-Sicherheitsrat […]
Der Beitrag Prof. Jeffrey Sachs: Scharfe Kritik an den USA vor der UN wegen Venezuela erschien zuerst auf acTVism.
Prof. Jeffrey Sachs – Angriff auf Putins Residenz & warum Europa keinen Frieden will
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Gründer und unterstützender Redakteur Zain Raza mit Prof. Jeffrey Sachs, dem weltbekannten Ökonomen und UN-Berater, […]
Der Beitrag Prof. Jeffrey Sachs – Angriff auf Putins Residenz & warum Europa keinen Frieden will erschien zuerst auf acTVism.
USA, Venezuela und die Trümmer des Völkerrechts
Deutschlands Niedergang und Europas Bruchpunkt | Prof. Richard Wolff
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Interview spricht unser Gründer und unterstützender Redakteur Zain Raza mit Richard D. Wolff, Professor für Wirtschaftswissenschaften, über den wachsenden wirtschaftlichen Druck, […]
Der Beitrag Deutschlands Niedergang und Europas Bruchpunkt | Prof. Richard Wolff erschien zuerst auf acTVism.
Prof. Jeffrey Sachs – US-Angriff auf Venezuela & Europas Feigheit
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Gründer und Redakteur Zain Raza mit Prof. Jeffrey Sachs, einem weltbekannten Ökonomen und UN-Berater, über […]
Der Beitrag Prof. Jeffrey Sachs – US-Angriff auf Venezuela & Europas Feigheit erschien zuerst auf acTVism.
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »